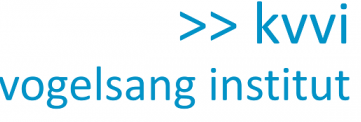Eine Würdigung von Univ.-Prof. Dr. Dieter A. Binder (Universität Graz),
langjähriger Leiter des wissenschaftlichen Arbeitskreises des Karl von Vogelsang-Instituts und stv. Vorsitzender des Instituts.
Univ.-Prof. Dr. Ernst Bruckmüller. Ein stiller Großer wird 80 Jahre
„Ich stelle mir Ernst Bruckmüller als einen glücklichen Menschen vor – akkurat frisiert -, der in allen Lebensstationen in sich selbst ruht, präzise beobachtet und daraus intelligente Schlüsse zieht.“
Geboren in den letzten Tagen der Nazi-Zeit und des Krieges am 23. April 1945 in Eselsteiggraben, das im Ortsgebiet von St. Leonhard am Forst liegt, was dem Nicht-Niederösterreicher auch noch nicht viel sagt, besuchte er im nahegelegenen Melk das Stiftsgymnasium. Den ambitionierten Schülern dieses Benediktinerklosters stand in der Freizeit die Teilnahme an der Kongregation oder an der katholischen Pennalie offen. Da wohl das Beten und die geistliche Erbauung von den Patres ohnehin intensiv weitergegeben wurden, entschied sich Ernst für die K.Ö.St.V. Nibelungia, einem Milieu, dem er auch ab 1963 als Geschichte- und Germanistikstudent in Wien treu blieb, was ihn in die K.a.V Norica führte. Als Kind aus einem bewusst christlichsozialen Milieu und als Niederösterreicher nahezu selbstverständlich österreichisch geprägt – den Deutschnationalismus überließ man eher jenen, deren Deutschtum in einem scheinbaren Widerspruch zu ihren Familiennamen stand – erfuhr er bei der Norica durch Wolfgang Mantl den zur Reflexion einer derartigen Befindlichkeit notwendigen Unterbau. Gerade in und um die Norica fanden sich damals jene jungen Katholiken, die geprägt von der Aufbruchsstimmung des II. Vatikanums überkommene Strukturen kritisch in Frage stellten und offen waren für Neues. Werner Vogt war einer von ihnen und Alois Mock, der als Unterrichtsminister die echte Drittelparität an den Universitäten einführen wollte, war ein anderer. Mit der Promotion 1969 wurde er Assistent am legendären Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte unter Alfred Hoffmann, unter dem bereits der etwas ältere Michael Mitterauer und bald danach der etwas jüngere Roman Sandgruber ebenfalls als Assistenten arbeiteten, und habilitierte sich 1976 für das Fach Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Im Jahr darauf zum Professor ernannt, hielt er seinem Institut bis zu Pensionierung die Treue. Versuche, ihn woanders hin zu berufen, stoppte er bereits im Vorfeld, indem er kollegiale Anfragen freundlich und bestimmt zurückwies.
Ich stelle mir Ernst Bruckmüller als treuen und ausdauernden Menschen vor, der dem gemeinsam mit Rainer Stepan gegründeten Karl von Vogelsang-Institut zur Geschichte der christlichen Demokratie in Österreich als Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats und Vizepräsident diente. In den schwierigen 1980er Jahren sammelte er hier arrivierte und junge Kollegen, um Projekte zur Geschichte des christlichsozialen Lagers voranzubringen, damals wie teilweise auch noch heute umstrittene Fragen deren Geschichte kontrovers zu diskutieren, schlicht der Wissenschaft zu dienen. Wiewohl er diese Funktion 1991 niederlegte, nachdem er zum Vorsitzenden des Instituts für Österreichkunde gewählt worden war, blieb er dem Institut als Ratgeber, Förderer und Mitdenker erhalten. Das neue Aufgabenfeld, hier zeigte sich wiederum der begnadete Netzwerker und Nachwuchsförderer, nahmen seine Kraft bis in die jüngste Vergangenheit in Anspruch. Das Institut, 1954 mit der Planung zu einem ersten österreichischen Historikertag entstanden, ist eine bundesweite Arbeitsgemeinschaft zur freiwilligen Fortbildung der Lehrerschaft auf den Gebieten Geschichte und Politik, Literatur und Sprache, Geografie und Wirtschaft. Ein jährlicher Kanon von Tagungen (für Geschichte, Literaturwissenschaft und Geografie) und die Herausgabe der Zeitschrift „Österreich in Geschichte und Literatur“ sowie die Edition der Schriftenreihen des Instituts lassen den Einsatz von Bruckmüller erahnen, der angesichts zunehmender staatlicher Sparzwänge ins Heroische gewachsen ist. Der Fokus dieses Instituts liegt auf der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung, der auch die von ihm 1971 mitbegründeten „Beiträge zur Historischen Sozialkunde“ gewidmet sind und an deren Redaktion er bis 2001 regen Anteil hatte. Auch hier folgt auf die Entlastung sofort eine neue Aufgabe: Als Vorsitzender und Motor diente er ab 2002 dem Ludwig-Boltzmann-Institut für die Geschichte des ländlichen Raumes, das er als Vorsitzender des Instituts für Geschichte des ländlichen Raumes in St. Pölten ab 2005 fortführte.
Ich stelle mir Ernst Bruckmüller als forschungsbasierten akademischen Lehrer an der Universität Wien, als Gastprofessor an der „École pratique des hautes études“ an der Sorbonne IV und als engagierten Ausstellungskurator und Volksbildner im Hörsaal, im Radio und im Fernsehen vor. Ich stelle ihn mir also als Geschichtserzähler im besten Sinne des Wortes vor. Diese Tätigkeit lässt vier markante Arbeitsschwerpunkte sichtbar werden: Agrargeschichte, Bürgertumsforschung, Sozialgeschichte, Nationsbildung und -bewusstsein. All dies fließt in seine stete Auseinandersetzung mit dem Raum, mit Österreich ein, ohne dies ahistorisch zu verknappen oder gar revisionistisch zu erweitern. Dieses Leitthema wird 1984 in seinem Buch „Nation Österreich. Sozialhistorische Aspekte ihrer Entwicklung“ für die Öffentlichkeit sichtbar. Er stellte sich damit in die Reihe jener älteren Historiker und Soziologen, wie die CVer Ernst Karl Winter, Friedrich Heer und August Maria Knoll, die im Widerspruch zur dominanten Wiener Tradition deutschnationaler Geschichtsschreibung das Spezifische einer Region jenseits der Sprache suchten. Das hat Bruckmüller, der die Debatte auf der Ebene der modernen Nationstheorien führte, heftige Angriffe von einer Nachlassverwalterin der abgekommenen deutschen Reichsgeschichte eingetragen. Seine Replik las ich als eine allgemein gültige Zurückweisung der politischen Instrumentalisierung von Geschichtsschreibung. Dieser Band fand mehrfach überabeitet und neu aufgelegt auch den Weg in eine amerikanische Übersetzung (2003). Seine „Sozialgeschichte Österreichs“, erstmals 1985 auf den Markt gekommen, wurde 2003 in einer französischen Übersetzung in Paris aufgelegt. Sein Ringen um eine Gesamtschau Österreichs ließen ihn den Versuch wagen, in einer Monografie der österreichischen Geschichte von der Vorzeit bis in die Gegenwart nachzuspüren (2019). Ernst Bruckmüllers Blick auf die österreichische Geschichte geht nicht den einfachen Weg vom Zentrum in die Peripherie, sie geht vielleicht biographisch beeinflusst, von der Provinz zum Zentrum. Dem Regionalen im niederösterreichischen Kontext ist Bruckmüller ebenso verhaftet wie dem dezentralen Geschehen. Seine das Leben bis heute gestaltende Begegnung mit Irena Vilfan-Bruckmüller öffneten den Blick und sein Wissen um den slowenischen Raum und dessen Geschichte. Die Wertschätzung, die ihm hier entgegengebracht wird, spiegelt sich in seiner Publikationsliste und nicht zuletzt in der 2017 erfolgten slowenischen Ausgabe seiner „Österreichischen Geschichte“ zwei Jahre vor der deutschsprachigen Erstausgabe. Seine stete Reflexion des historischen Raums, der historischen Geografie ließen ihn 2011 zum Herausgeber des „Putzgers“, genauer gesagt der 104. Auflage des „Historischen Weltatlas“ werden. Es wäre anmaßend und gleichermaßen überfordernd, auch nur ansatzweise hic et nunc eine kommentierte Bibliografie Bruckmüllers folgen zu lassen. Über 20 Monografien, rund 50 Herausgeberschaften und Redaktionen, darunter eine große Zahl von Lieferungen des Österreichischen Biografischen Lexikons, und 250 Aufsätze sprechen für sich. Sein Œuvre, für das er den Karl-von-Vogelsang-Staatspreis für Geschichte der Gesellschaftswissenschaften (1983), den Wissenschaftspreis des Landes Niederösterreich (2000) und den Kardinal-Innitzer-Preis (2019) erhielt, veranlasste der Akademie der Wissenschaften ihn 2003 zum Korrespondierenden und 2006 zum Wirklichen Mitglied zu wählen.
Unterschiedliche Quellengattungen werden fachgerecht in der kritischen Geschichtsschreibung hinterfragt, so auch die „Laudatio“. Doch bevor ein Zwischenruf dieser Art von Ernst Bruckmüller, ich stelle ihn mir als bescheidenen Menschen vor, kommt, sei eines noch gesagt: Seinen Kolleginnen und Kollegen tritt er mit offener Sympathie entgegen, seinen Studentinnen und Studenten ist er ein stets wohlwollender Förderer und Lehrer, vielen von uns aber war und ist er ein echter Freund und Bruder.
Das Karl von Vogelsang-Institut gratuliert seinem Mitbegründer Ernst Bruckmüller von ganzem Herzen!