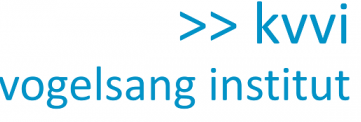Zur Aktualität eines aussichtslosen Kampfes um Unabhängigkeit von Prof. Dr. Johannes Schönner, Geschäftsführer des Karl von Vogelsang-Instituts
Das Juli-Abkommen vom 11. Juli 1936 markiert bis heute die Schwäche eines Kleinstaates gegenüber dem Angriffsfuror eines feindlichen Nachbarn. Jahrelanger Terror, Sprengstoffanschläge und permanente Drohungen zwangen das autoritär regierte Österreich zu harten Kompromissen gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland. Hinzu kam ein wirtschaftlicher Druck, der nur mit Sanktionen und Erpressung zu beschreiben war. Die Intensität der deutschen Forderungen und Aggression begannen bereits 1933 mit der Machtübernahme Hitlers. Sie steigerten sich seit 1934, als Hitlers Handlanger in Wien Engelbert Dollfuß ermordeten und nur durch Aufbieten aller staatlichen Kräfte niedergekämpft werden konnten.
Je nach ideologischer Färbung beklagen Bürgerliche bis heute den marxistischen Universalismus der Sozialdemokratie, der gegenüber dem Ständestaat mehr Abscheu zeigte als gegenüber dem Nationalsozialismus (Bruno Kreisky) und deren Führung von einer „Diktatur des Proletariats“ träumte. Während die Sozialdemokraten nach ihrem gescheiterten Aufstand im Februar 1934 die Auseinandersetzung zwischen dem autoritären Ständestaat und dem Nationalsozialismus im Untergrund abwarteten und deren Kader beide rivalisierende Systeme heftig ablehnten. Was im Übrigen nicht verhindern konnte, dass die NS-Agitation auch bei jungen Arbeitern, Angestellten und auch in der lohnabhängigen Landarbeiterschaft von Jahr zu Jahr erfolgreicher wurde und ständig mehr Sympathisanten fand.
Das Juli-Abkommen war im Grunde das Eingeständnis des bevorstehenden Scheiterns. Als direkte Auswirkungen des Abkommens müssen neben dem Fall der „1000-Mark-Sperre“ und den sich normalisierenden Wirtschaftsbeziehungen, der damit verbundenen erhöhten deutschen Durchdringung des österreichischen Wirtschaftslebens, auch die Ernennungen von Edmund Glaise-Horstenau und Guido Schmidt zu Mitgliedern der Bundesregierung in Wien angesehen werden. Damit hatten die „betont Nationalen“ Schlüsselpositionen erreicht, die fortan eine Politik gänzlich an Berlin vorbei nicht mehr zuließ. Wenngleich mit dem Abkommen die faschistische und Italien-freundliche Heimwehrbewegung unter Starhemberg endgültig entmachtet worden war. Hitler setzte sich hinsichtlich der „weitreichenden politischen Amnestie“ für österreichische Nationalsozialisten durch. Die erhoffte „innere Befriedung“ hielt dem folgenden Ansturm nicht stand.
Welche Erkenntnis bleibt also?
Ein kleiner Staat wird international zum Spielball, internationale Unterstützungserklärungen waren oftmals das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben waren. Schließlich zeigte die Zeitspanne um das Juli-Abkommen 1936 auch klar, dass der größte Feind oftmals nicht außerhalb, sondern innerhalb der Grenzen stand. Ohne der österreichischen Nationalsozialisten hätte Hitler keines seiner Ziele hier erreichen können. Bemerkenswert erscheint auch ein Blick auf die Jugend, hier speziell auf die Schulen. Gerade die Jungen lehnten zunehmend die Österreich-Ideologie des Ständestaates ab und empfanden „großdeutsch“. Wer die Schulen dominiert, dem gehört – dieser Satz ist zeitlos – in ein paar Jahren das Land. Das traf auch auf Wien zu: Selbst die sozialdemokratische Färbung der Wiener Schulen (Otto Glöckel) machte nicht immun gegen NS-Propaganda. Der Fanatismus, die kalkulierte Unbeherrschtheit und der „Reiz des Neuen“ führte – zusätzlich zu anderen bekannten Motiven (Arbeitslosigkeit) – viele Jugendliche ins Lager des Nationalsozialismus.
Dennoch: Der Ständestaat, obzwar undemokratisch und autoritär, kämpfte für Österreichs Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Somit ist es falsch die Opferthese generell als „Lebenslüge“ abzutun. Das Juli-Abkommen ist ein Beleg für die eigene Schwäche, aber auch für den Versuch, auf Zeit zu spielen und solcherart eine Trendumkehr zu ermöglichen. Ebenso ist das Abkommen ein Vorwurf an alle internationalen Mächte, die Österreich im Stich ließen und schließlich diesen Vertrag für Wien überhaupt erst notwendig machte.
Die „Stresa-Front“, vollmundig im Frühjahr 1935 von den Westmächten und von Italien gegen Hitler-Deutschland verkündet, war nicht mehr spürbar. Folglich führte der „Juli 1936“ direkt zum „März 1938“. Gerade in dieser Hinsicht könnte sich die Aktualität zu zahlreichen gegenwärtigen Entwicklungen zeigen.