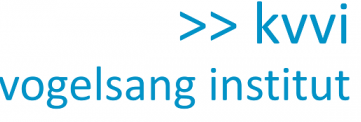Karl Lueger wurde 1844 als Sohn eines Saaldieners am Wiener Politechnikum geboren. Nach seiner Matura studierte er Jus und schlug die Rechtsanwaltslaufbahn ein. Bald zeigte sich sein außergewöhnliches Rednertalent und Lueger begann sich in den frühen 1870er Jahren im demokratischen, in der Terminologie der damaligen Jahre „linken“ Flügel der liberalen Bewegung Wiens zu betätigen. In weiterer Folge brach er mit den Liberalen und versuchte sich vor allem als Kämpfer gegen die Korruption des liberalen Establishments im Rathaus einen Namen zu machen. Doch blieb seine politische Laufbahn von wiederholten Rückschlägen gekennzeichnet. An einem dieser Tiefpunkte, 1883, begann die enge Zusammenarbeit mit seinem späteren engen Mitstreiter in der christlichsozialen Partei, Albert Gessmann. Die beiden demokratisch im Sinne einer Erweiterung des Wahlrechts eingestellten Außenseiter bildeten damals eine allseits belächelte „Zweimannpartei“ im Gemeinderat, dem Lueger 1875/76 und dann von 1878 bis zu seinem Tod angehörte. 1885 errang er ein Mandat im Abgeordnetenhaus des Reichsrates und ab 1890 gehörte er dem Niederösterreichischen Landtag an.
Mitte der 1880er Jahre ging Karl Lueger mit Blick auf die Handwerker und Gewerbetreibenden dazu über, in seinen Reden das Potenzial des politischen Antisemitismus gezielt einzusetzen. Zugleich erkannte Lueger, dass er das inhaltliche Profil seiner gegen den Liberalismus gerichteten bürgerlichen Sammelbewegung um eine positive Programmschiene, am besten auf sozialpolitischem Gebiet, ergänzen müsse. Er knüpfte Kontakte zum Kreis der katholischen Sozialreformer um Karl von Vogelsang. Beginnend mit dem zweiten österreichischen Katholikentag im April 1889 begann Karl Lueger, öffentlich mit dem Politischen Katholizismus zu sympathisieren. Schrittweise entwickelte sich unter seiner Führung ab Beginn der 1890er Jahre die rasch anwachsende Christlichsoziale Partei. Nach anfänglichen Spannungen schlossen sich ihr die Katholisch-Konservativen an. Durch den 1907 erfolgten Zusammenschluss auf der Ebene des Reichsrates wurden die Christlichsozialen zur größten Fraktion im Abgeordnetenhaus.
Luegers Rhetorik definierte mit den Ungarn und Juden konkrete Feindbilder. Seinem „Wortantisemitismus“ (Anton Pelinka), der sich bedauerlicherweise bei Vertretern aller Massenparteien um die Jahrhundertwende fand, ließ er allerdings nie eine politische Umsetzung folgen.
1895 errang Lueger erstmals die Mehrheit im Wiener Gemeinderat, doch scheiterte seine Wahl zum Bürgermeister drei Mal am Veto Kaiser Franz Josephs, was seine persönliche Popularität zusätzlich verstärkte. Er musste sich vorerst mit der Funktion des Vizebürgermeisters begnügen. Im Frühjahr 1897 wurde er dann von Franz Joseph als Bürgermeister bestätigt. Er übte diese Funktion 13 Jahre lang aus und verwirklichte in dieser Zeit ein umfangreiches Reformprogramm. Sein „kommunaler Sozialismus“, im Zuge dessen er die Gasversorgung, den öffentlichen Verkehr etc. der Gemeinde übertrug, wurde zu einer urbanen Erfolgsgeschichte. In der Gesundheits- Sozial- und Bildungspolitik setzte er mit seinen Projekten neue Maßstäbe. Seine städtebaulichen Konzepte wiesen Wien den Weg in die Moderne.
Auf der Ebene des Reichsrates trug Lueger als Obmann und Fraktionsführer seiner Partei maßgeblich zu der vom Reichsrat 1906 beschlossenen Wahlrechtsreform bei, mit der anstelle des bisherigen Kurienwahlrechts das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Männer eingeführt wurde, und führte seine Partei erstmals in die Regierungsverantwortung. Karl Lueger selbst, wohl auch, weil bereits gesundheitlich geschwächt, trat in keine Regierung ein, sondern verblieb in seiner Funktion als Wiener Bürgermeister, die er bis zu seinem Tod 1910 innehaben sollte.