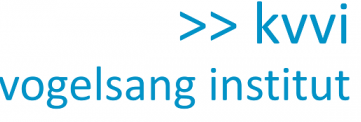Ignaz Seipel
Ignaz Seipel kam 1876 als Sohn eines Fiakers in Wien auf die Welt. Hier trat er nach der Matura in das Priesterseminar ein und studierte Theologie. 1899 wurde er zum Priester geweiht. Er war einige Jahre als Kaplan tätig, ehe er sich der Wissenschaft zuwandte und sich 1908 für das Fach Moraltheologie habilitierte. Nur ein Jahr später wurde er als Ordinarius an die Universität Salzburg berufen. Während des Ersten Weltkriegs erschien 1916 seine Studie „Nation und Staat“. Mit den darin formulierten Lösungsvorschlägen zum Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie zog Seipel erstmals die Aufmerksamkeit breiterer politischer Kreise auf sich. 1917 übernahm er in der Nachfolge Franz Martin Schindlers, des Verfassers des ersten christlichsozialen Parteiprogrammes 1891, dessen Lehrstuhl an der Universität Wien und wurde rasch zu einem Hoffnungsträger innerhalb der Christlichsozialen Partei.
Als Heinrich Lammasch am 22. Oktober 1918 zum letzten k.k. Ministerpräsidenten ernannt wurde, trat Seipel als Sozialminister in die Regierung ein. Er war maßgeblich an der Formulierung der schließlich von Kaiser Karl akzeptierten Verzichtserklärung beteiligt und trug wesentlichen Anteil daran, dass weite Teile der christlichsozialen Gefolgschaft den Übergang zur Republik akzeptierten. Mit seiner Wahl in die Konstituierende Nationalversammlung begann 1919 seine Tätigkeit als Parlamentarier, die er bis zu seinem frühen Tod 1932 ausüben sollte. 1920 war er als christlichsozialer Hauptverhandler federführend an der Erarbeitung der Bundes-Verfassung beteiligt.
Im Jahr 1921 übernahm er den Parteivorsitz innerhalb der Christlichsozialen und trat 1922 an die Spitze der Regierungskoalition mit den Großdeutschen. Noch im selben Jahr erreichte Seipel beim Völkerbund eine Anleihe in der Höhe von 650 Millionen Goldkronen, mit der der drohende wirtschaftliche Zusammenbruch Österreichs abgewendet werden konnte. In weiterer Folge gelang es Seipel, die Hyperinflation zu stoppen, den Staatshaushalt zu stabilisieren und die Einführung einer neuen Währung, des Schillings, vorzubereiten. Seine teils harten Sanierungsschritte machten Seipel zum Feindbild nicht nur der Opposition, sondern auch derjenigen Bevölkerungsschichten, die an den Auswirkungen der Maßnahmen am schwersten zu tragen hatten. Im Juni 1924 wurde auf ihn ein Revolverattentat verübt, bei dem Seipel schwer verletzt überlebte. Er trat im November 1924 als Bundeskanzler zurück.
Im Oktober 1926 übernahm er nach dem Scheitern der Regierung Ramek neuerlich die Kanzlerschaft. Seine zweite Regierungsperiode war geprägt von den immer härter werdenden Auseinandersetzungen zu Fragen des Verhältnisses von Staat und Kirche. Insbesondere auf Grund seines Verhaltens nach dem Brand des Justizpalastes vom 15. Juli 1927, bei dem für ihn allein die Staatsräson maßgeblich war, verbanden die Sozialdemokraten ihre kirchenfeindliche Agitation unmittelbar mit seiner Person. Dies führte bei Seipel zu einem zunehmenden Liebäugeln mit autoritären Regierungsmodellen und der Heimwehr. 1929 trat er überraschend zum zweiten Mal als Bundeskanzler zurück. Für kurze Zeit gehörte er 1930 der Minderheitsregierung Vaugoin als Außenminister an. Im Jahr 1931 wurde er nochmals mit der Regierungsbildung beauftragt. Sein Versuch, eine Konzentrationsregierung zu bilden, scheiterte an der Sozialdemokratie. Deren Misstrauen Seipel gegenüber war zu groß, um unter ihm in ein Kabinett einzutreten.
Zu Beginn der 1930er Jahre begann sich der Gesundheitszustand Seipels rasch zu verschlechtern. Er war zuckerkrank, eine Kugel des Attentats war in seinem Lungenflügel verblieben, eine Tuberkuloseerkrankung kam dazu. Er verschied, erst im 57. Lebensjahr stehend, Anfang August 1932. Mit ihm starb der bedeutendste, wenngleich auch umstrittenste Priester-Politiker der Ersten Republik.